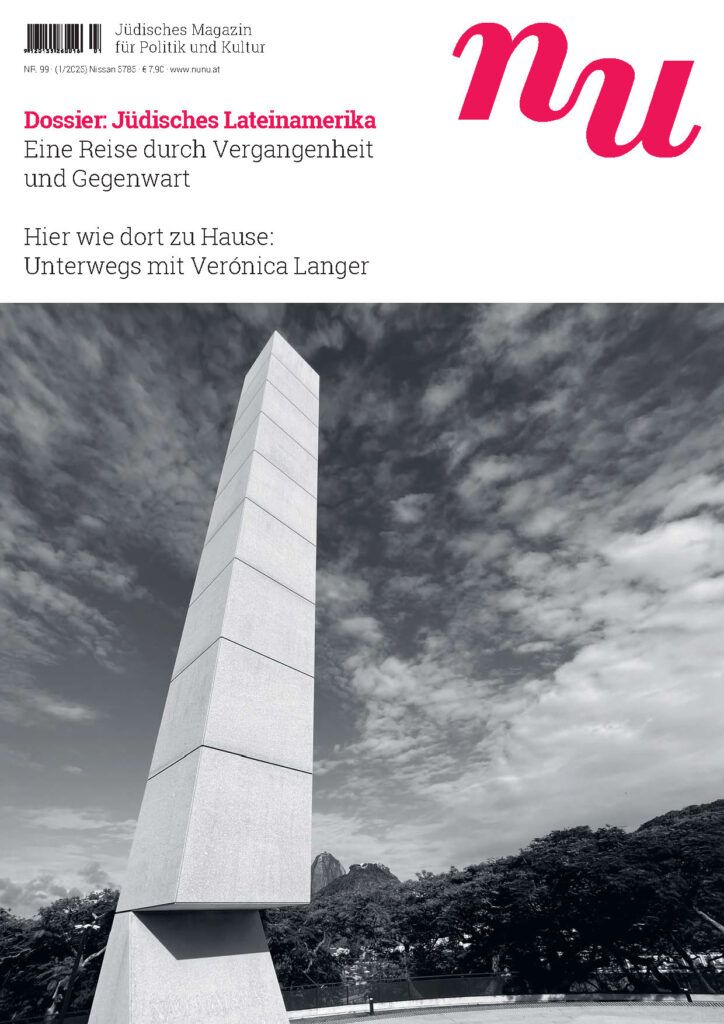Zum 150. Geburtstag Arthur Schnitzlers wurden in Reichenau zwei seiner Theaterstücke gespielt. Eine Nachlese.
Von Ida Labudovic
Da sitzt er, der junge Arthur Schnitzler, vor dem offenen Fenster und einem weißen durchsichtigen Vorhang im Saal des Thalhofs. Einst gehörte dieses Haus mit kulturellem Flair der Wirtin Olga Waissnix, die Tochter des Besitzers des Südbahnhotels am Semmering. Schnitzler nannte sie das „Abenteuer meines Lebens“. Der Geruch von nassem Gras, die Sommerfrische und das Begehren zu Adele Sandrock erweckten ihn. Die berühmte Schauspielerin und er begegneten einander bei den Proben zum „Märchen“, Schnitzlers erstes Stück, das für die große Bühne gedacht war. Die intensive Beziehung dauerte etwa eineinhalb Jahre und war geprägt von Leidenschaft und Abneigung. Übrig blieben 200 expressive Briefe, die die Grundlagen für den Einakter Ach, Arthur darstellten und von Helga David im Thalhof in Reichenau an der Rax inszeniert wurden. In der Festspielsaison 2012 wurde Schnitzler in Reichenau gleich zwei Mal gewürdigt. Im Neuen Spielraum im Theater Reichenau brachte Helmut Wiesner Reigen auf die Bühne.
Der verfallene Fin-de-Siècle-Ballsaal des Thalhofs und seine Aura sind in Ach, Arthur der Austragungsort von wechselnden Stimmungen und Gefühlen zwischen der Schauspielerin und dem Dichter. Aus der Angst nicht verletzt zu werden, verletzen sie einander ständig. Sie erwarteten viel von einander, sodass sie es nie schaffen konnten, länger zusammen zu bleiben. Obwohl Schnitzler ein aufmerksamer Beobachter und Analytiker war, konnte er Adeles emotionalen Ausbrüche nicht aufarbeiten. Untreu waren beide, was zur Trennung führte. Im Drama Reigen hat Schnitzler seine Beziehung mit Adele Sandrock, in der Begegnung zwischen dem Dichter und der Schauspielerin in der achten Szene nachgebildet.
Trotz des Bruchs zwischen Adele Sandrock und Schnitzler brachte das Stück Liebelei den beiden im Jahr 1895 den großen Erfolg. Die Problematik der außerehelichen Liebe, die in der Zeit der Wiener Moderne typisch war, wurde zum gesellschaftlichen Thema. In diesem Theaterstück kommt eine Klassenteilung vor: Einerseits die verheiratete Frau aus der Oberschicht und die Beziehung mit ihr, die gesellschaftliche Komplikationen mit sich bringt. Andererseits das süße Mädel, das mit ihrer Zärtlichkeit und Herzenswärme Schnitzlers Interesse weckte und zu einem literarischen Begriff wurde. Auch das Thema Ehebruch kommt im Reigen vor. Das Bühnenwerk löste einen Theaterskandal aus, auch weil es die Zeitlosigkeit dieses Themas zeigte und die großbürgerliche Gesellschaft durchleuchtete. Als 1920 Reigen in Berlin aufgeführt wurde, stellte die Staatsanwaltschaft die Direktion des Kleinen Schauspielhaus, den Regisseur und die Darsteller wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses vor Gericht. Verteidiger Wolfgang Heine sagte damals, dass es „immer weniger um Schnitzler geht und immer mehr um nationalistisch- rassische Interessen“. Das Gericht wurde mit einer doppelten Fragestellung konfrontiert: Erstens, ist „das dargestellte Stück an sich unzüchtig“, und zweitens, „haben sich die Darsteller objektiv im Einzelnen unzüchtige Handlungen zuschulden kommen lassen?“. Das Ergebnis war, dass das Stück einen sittlichen Gedanken verfolgt und der Dichter zeigen wollte, wie falsch sich das Liebesleben abspielt und zur „Besserung der Gesellschaft beitragen“ wollte.
Im Zentrum des Neuen Spielraums im Theater Reichenau befindet sich ein opulentes Bett. Die Inszenierung des Reigen stammt von Helmut Wiesner, der schon acht Mal Regie bei verschiedenen Schnitzler-Bühnenstücken führte. Die zehn Liebesreigen- Szenen wurden jeweils mit einem von Schnitzler komponierten Walzer getrennt. Es beginnt mit der Dirne und dem Soldaten. Das Bett besteht nur aus einem Brett und ist einfach, so wie die Gespräche dieses Paars. Gefühle sind kein Thema. Je höher die soziale Schichte in den folgenden Szenen, desto komplizierter wird es zwischen den Menschen. Am Anfang steht großes Begehren, am Ende meist eine Enttäuschung, die schnell zum Auseinandergehen führt. Nach der Leidenschaft bleibt die Banalität. Die am meisten berührende Szene kommt am Ende. Nach einer durchzechten Nacht mit seinem Freund befindet sich der Graf im Zimmer der Dirne. Sie kommen einander emotionell sehr nah und das ist die einzige Szene, in der das Paar nicht miteinander schläft. So schließt sich der Kreis des Liebesreigens.
Wegen seiner Beschäftigung mit dem psychologischen Aspekt des sexuellen Verhaltens wurde Schnitzler als literarisches Pendant zu Sigmund Freud bezeichnet. „Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Sie durch Intuition alles das wissen, was ich in mühseliger Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe“, schrieb Freud an Schnitzler.
Arthur Schnitzler war ein introvertierter und mitfühlender Mensch. Er liebte in seinem Leben viele Frauen, das Spazierengehen und Wien, den Ort seines Lebens und seiner Werke. Er war eine starke Identifikationsfigur, sein Wien hat er nie verlassen. Eine Stadt der Gemütlichkeit, Kaffeehäuser, Kunst, Erotik und der Lebenslüge, die sich in der Gesellschaft etabliert hat. Schnitzler gehörte dem gehobenen Bürgertum an und verspürte gesellschaftliche Zwänge. Er kritisierte scharf das, was verboten war auszusprechen. Mit seiner ungeheuren Sprachbeherrschung kämpfte er gegen Antisemitismus, gegen Intrigen und Doppelmoral der Gesellschaft, die er mit Sarkasmus beobachtet und demaskiert hat. Das schaffte ihm viele Feinde. Er schrieb über eine Zeit der Widersprüche und schuf literarische Bilder von Prateralleen, Donauufer und großbürgerlichen Wohnungen. Von Anfang an wurde er nicht nur wegen der Thematik seiner Werke, sondern auch aus antisemitischen Motiven angegriffen.
Die Zwanzigerjahre brachten Schnitzler Schwierigkeiten. Seine Ehe wurde geschieden, die Tochter beging Selbstmord und immer öfter spürte er den wachsenden Antisemitismus. Er zog sich immer mehr zurück und lud einen kleinen Freundeskreis prominenter Schriftsteller, wie Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten, Franz Werfel und Fritz von Unruh, in sein Haus in der Sternwartestraße ein. In seinem Leben fühlte er sich einsam, war nachdenklich und melancholisch. Die Unsicherheit des Lebens machte ihn unglücklich. Er war ein Wahrheitssucher, der die menschliche Seele durchleuchtete und bis heute aktuell geblieben ist.