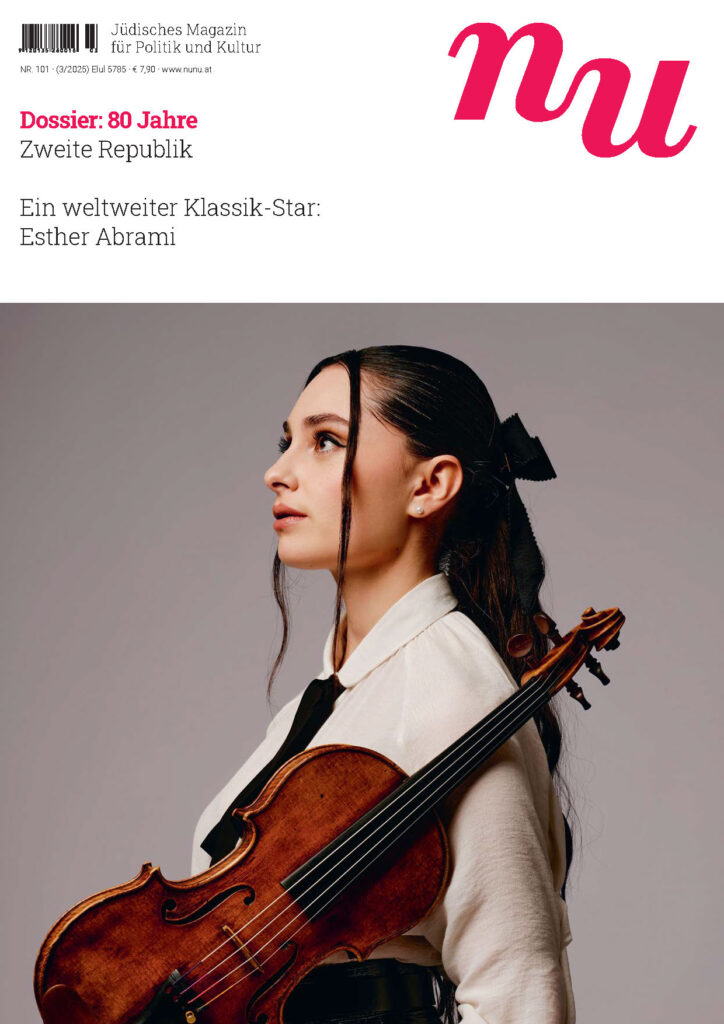Das wiedereröffnete Jüdische Museum in Wien zeigt sich publikumswirksam und aufgeräumt. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Palais Eskele eigentlich kein geeigneter Museumsbau ist.
Von Barbara Tóth (Text und Fotos)
Früher konnte es einem passieren, dass man am Jüdischen Museum Wien unabsichtlich vorbeilief, so beiläufig bot sich der Eingang des Palais Eskele in der schmalen Dorotheergasse dar. Das kann nach der Wiedereröffnung diesen Herbst nach neunmonatiger Renovierung nicht mehr geschehen. Wer vom Graben in Richtung Museum einbiegt, dem leuchten schon von weitem die hebräischem Buchstaben in gleißenden, weißen Neonlicht entgegen, sie bringen nicht nur die Fassade des Museums zum Strahlen, sondern geben der Dorotheergasse ein neues Zentrum. „Museum“ bedeutet der Schriftzug übersetzt, gestaltet wurde er von der Künstlerin Brigitte Kowanz.
Es ist nur einer von vielen Kunstgriffen, der das kleine Stadtpalais, seit 1993 Heimat des Jüdischen Museums Wien, einladender, publikumswirksamer und heller wirken lässt. Der Eingangsbereich wurde komplett neu geordnet, Wanddurchbrüche lassen Besucher intuitiv ihren Weg finden: geradeaus zum Informationsschalter und der Kassa, links in die traditionelle Buchhandlung Singer, rechts zum Buffet. Die Handschrift der Direktorin Danielle Spera, Mitbegründerin von NU, ist unverkennbar. Mit seinem in weiß gehaltenen Pulten sehr aufgeräumt, aufs Wesentliche reduziert, stolz – als Logo dient ein roter Davidstern – und dank der vom Denkmalschutz eingeforderten Wiederherstellung der Marmorwände sehr elegant, wirkt das runderneuerte Entrée.
Die Wiedereröffnung des Hauses wurde mit großer Spannung und – man kann es nicht anderes sagen – auch einer gewissen Häme erwartet. Vorausgegangenen war eine beispiellose Aufregung, nachdem im Zuge der Bauarbeiten ein Set von Hologrammen zu Bruch gingen, die Teil der ehemaligen Dauerausstellung gewesen waren. Obwohl sie für die neue Dauerausstellung nicht vorgesehen waren und auch ein zweites Ersatzset vorhanden waren, empörten sich jüdische Museumsmitarbeiter quer durch Europa über die „Zerstörung“ dieser Stücke, die vom Ausstellungsaccessoires zu eigenständigen Kunststücken hochgelobt wurden. Die ehemalige ORF-Journalistin Spera hatte als Quereinsteigerin in den Museumsbetrieb ohnehin nicht mit Vorschusslorbeeren zu rechnen, die Hologramm-Causa bot den idealen Anlass, sie öffentlich zu attackieren.
Wie also würde Spera ihr neues Haus positionieren? Welche Akzente würde sie setzen? Wer von Skeptikern auf Anlass für Kritik hoffte, wurde enttäuscht. Spera und ihr neuer Chefkurator Werner Hanak-Lettner entschieden sich für eine Art museumspolitische Atempause. Die alte Dauerausstellung ist Geschichte, die neue soll Ende 2012 präsentiert werden, die Phase dazwischen überbrückt das Museum mit einer Art „Work in Progress“-Schau im Atrium des Hauses. Dieses ist – und das ist das eigentliche Problem des Museums, das in der aufgebrachten Debatte über Hologramme und die Person Spera viel zu kurz kam – der einzige Raum des Hauses, der große gestalterische Gesten erlaubt.
Warum sind Sie hier? Was soll ein jüdisches Museum bringen? Kann man den Holocaust verstehen? Fragen wie diese werden entlang drei Arbeitstischen gestellt, der Besucher kann eigene Antworten aufschreiben oder in einem Mini-Fernsehstudio auf Video sprechen, später werden sie dann Teil der Ausstellung. Präsentiert werden wenige ausgesuchte Stücke, die gerade wegen dieser Reduzierung besonders bewegend sind und gleichzeitig Ausblicke bieten auf das, was kommen mag. Das sind zum einen Alltagsgegenstände wie eine kleine Schachtel mit Kinderspielzeug, die die Wirren des Holocaust überstanden hat und ihrer Besitzerin, die rechtzeitig flüchten konnte, wiedergegeben werden konnte – die Dame spendete sie dem Museum. Oder eine Stoffbahn mit gelben „Judensternen“, die die Maschinerie des Judenhasses besser verdeutlicht als vieles andere.
Aber auch eine Karteikartensammlung sowie hunderte Filmrollen der Fotografin Margit Dobronyi, die als Adabei der jüdischen Gesellschaft nach dem Krieg Familienfeste, Parties und Hochzeiten fotografierte – und damit eine einzigartige Dokumentation jüdischen Alltagslebens jenseits der Schrecken des Krieges aufbaute. Einen Tisch weiter sind jüdische Ritualgegenstände ausgestellt, die zu den jüdischen Feiertagen gebraucht werden. Über Kopfhörer bekommt man erzählt, welche persönliche Bedeutung sie haben – von Juden und Jüdinnen, die heute in Wien leben. An diesen wenigen Stücken wird sichtbar, was Spera gleich nach ihrer Berufung als ihr Ziel ausgegeben hat. Natürlich darf ein Jüdisches Museum den Holocaust nicht ausblenden, aber es soll auch jüdisches Leben danach dokumentieren – mit seinen Schatten- wie Lichtseiten.
Wer dann in den letzten Stock fährt, vorbei am ersten und zweiten Stock des Palais, die für Wechselausstellungen reserviert sind (derzeit Hollywood), bekommt einen Einblick in den „Fundus“ des Museums, also in jene Sammlungen, die den Grundstock des Archivs des Hauses ausmachen – und wohl auch Fundament der zukünftigen Dauerausstellung sein werden. Der Großteil stammt aus der Sammlung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien und umfasst Objekte und Inventare der Wiener Synagogen und Bethäuser, soweit sie nach dem Novemberpogrom 1938 noch vorhanden waren, sowie private liturgische Objekte wie auch persönliche Memorabilien, die Privatpersonen vor ihrer Deportation in der Kultusgemeinde abgaben. Die Provenienzforschung ist noch nicht abgeschlossen.
Die unzähligen Stücke des Schaudepots sind in massiven Archivschränken untergebracht. Neu sind kurze Videos, in denen weitere wichtige Sammlerpersönlichkeiten wie Max Berger porträtiert werden.
Eine Art Geheimtipp für alle politisch Interessierten ist die letzte Vitrine. Sie zeigt die eindrucksvolle Sammlung von Antisemitica des Wiener Unternehmers Martin Schlaff, die dieser 1993 dem Museum gestiftet hat. Spera, deren ZiB-erprobte Stimme durch viele Stationen des Museums führt, hat Schlaff dazu ausführlich interviewt. Das ist eine seltene Gelegenheit, dem öffentlichkeitsscheuen und geheimnisumwobenen Mann, „Österreichs einziger Oligarch“, wie „Profil“ ihn einmal nannte, zuzuhören.
Der Besuch des Jüdischen Museums ist nicht komplett, ohne die Dependance des Hauses am wenige Gehminuten entfernten Judenplatz zu sehen. Hier steigt der Besucher eine schmale Treppe hinab, sprichwörtlich durch die Jahrhunderte, bis er zu den Grundfesten der mittelalterlichen Judenstadt gelangt. Einige Mauerstücke des einstigen Tempels sind erhalten geblieben, eine 3DAnimation erklärt, wie das Leben im kleinen, blühenden jüdischen Viertel ausgeschaut hat, bevor es 1420/21 zerstört wurde. Wenige Vitrinen geben einen Überblick über die jüdische Kultur und ihre Bräuche zur damaligen Zeit. Als Kontrast dazu wartet im Erdgeschoss der Dependance moderne Kunst auf den Besucher.
Was also bleibt als vorläufiges Fazit? Das Jüdische Museum Wien im Palais Eskele verdient nach seiner Renovierung heute sicher mehr das Attribut „Schmuckkästchen“, das Spera ihm bei ihrem Amtsantritt verpasste, denn je zuvor. Es ist entstaubt und moderner, es signalisiert den Besuchern: Kommt herein, besucht mich. Seine ebenfalls neu überarbeitete Dependance am Judenplatz ist nicht nur eine wichtige „Außenstelle“, sondern hat wegen der unmittelbaren Nähe zum Schoa-Mahnmal von Rachel Whiteread und aufgrund der Ausgrabungen und der Fokussierung auf das Wiener Judentum im Mittelalter eine ganz eigene Ausstrahlung mit hoher Symbolik.
Beide Häuser, herausgeputzt wie sie sind, können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Wiens Museumslandschaft das Thema Zeitgeschichte (und damit unweigerlich auch das Thema Holocaust und Judentum) nach wie vor eine große Leerstelle darstellt. Das „Haus der Geschichte“, das sich der verstorbene Gründer des Jewish Welcome Service, Leon Zelman, zeit seines Lebens wünschte, wurde nie verwirklicht. Die Ideen für ein Museum österreichischer Zeitgeschichte, die unter Kanzler Alfred Gusenbauer zumindest laut angedacht wurden, sind wieder in irgendeine Schublade verräumt worden. Für ein Jüdisches Museum, das zeithistorische Aspekte umfassend mitnimmt, aber auch zum Gedenkort für den Holocaust werden kann, wie es Daniel Liebeskinds Neubau in Berlin schafft, ist das Palais Eskele schlicht und ergreifend zu klein, von seiner Dependance am Judenplatz ganz zu schweigen. Es ist schon ein Grenzgang, eine Dauerausstellung zum Judentum und eine Wechselausstellung im schmalen Haus in der Dorotheergasse unterzubringen. Besucher von „Hollywood“ müssen sich durch das schmale Stiegenhaus zwängen, die Schau bleibt – bei all ihrer Qualität – aufgrund der beengten Platzverhältnisse notwendigerweise an der Oberfläche.
Wann bekommt Wien das Museum, das der stolzen Geschichte seiner Juden, aber auch der Verantwortung, die Österreich am Holocaust trägt, gerecht wird? Diese Frage bleibt auch nach der Wiedereröffnung des Jüdischen Museums Wien unbeantwortet. Stellen muss sie sich nicht Spera, sondern die österreichische Politik.
JÜDISCHES MUSEUM WIEN
Haupthaus Dorotheergasse 11
Öffnungszeiten:
Sonntag bis Freitag 10–18 Uhr,
Samstags geschlossen
Dependance Judenplatz 8
Öffnungszeiten:
Sonntag bis Donnerstag 10–18 Uhr,
Freitag 10–14 Uhr,
Samstags geschlossen.
www.jmw.at