Seit dem 7. Oktober trägt Sepp Schellhorn die gelbe Schleife am Revers, auch in seiner Funktion als Staatssekretär. Ein Gespräch über Israel, Antisemitismus und den interkulturellen Dialog.
von Danielle Spera
Die gelbe Schleife symbolisiert die Anteilnahme am Schicksal der am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppten Zivilisten aus Israel in den Gaza-Streifen. Sepp Schellhorn trägt sie – als Mitglied der österreichischen Bundesregierung und zu offiziellen Anlässen. Dieses Engagement verdient es, bei uns einen Niederschlag zu finden. Was hat ihn dazu veranlasst?
Sepp Schellhorn: Ich wollte und will ein klares Zeichen setzen, dass wir für die Menschen, die von der Hamas entführt wurden, einzustehen haben, unter dem Motto „Bring them home“, also zuerst die Geiseln freizulassen. Es war mir ein persönliches Bedürfnis, auch bei der Angelobung dieses Zeichen zu setzen. Ich möchte zeigen, dass ich dahinterstehe. Eine Woche davor war ich bei meinem Sohn in Berlin und habe ihm den gelben Pin abgeluchst und gesagt: „Den brauche ich in den nächsten Wochen.“ Ich stehe an der Seite Israels.
NU: Haben Sie Israel schon besucht?
Sepp Schellhorn: Ich habe einen sehr guten Freund, Uri Buri. Er ist einer der bekanntesten Köche Israels. In seinem Restaurant in Akko bei Haifa in Nord-israel arbeiten Juden, Moslems und Christen. Ich durfte ihn schon mehrmals besuchen. Ich bin in ständigem Austausch mit ihm. 2021 wurde sein Restaurant von radikalen Islamisten verwüstet. Trotzdem setzt er sich für Versöhnung ein.
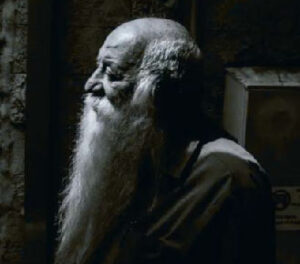
NU: Das heißt, Sie haben den 7. Oktober 2023 vielleicht bewusster erlebt als andere Österreicherinnen und Österreicher, weil Sie einen Bezug dazu haben.
Sepp Schellhorn: Ich habe immer einen Bezug zu Israel. Wir haben uns mit dem Land und seiner Geschichte beschäftigt und indirekt auch Verwandtschaft dort. Der Schwager meines Bruders lebt mit seiner Familie in Israel. Daher haben wir sofort Kontakt aufgenommen. Sein Sohn absolviert gerade seinen Militärdienst in der israelischen Armee, daher verfolgen wir das Geschehen mit Anspannung. Wir fühlen mit den Menschen und teilen ihre Sorgen und Ängste.
NU: Werden Sie auf die gelbe Schleife angesprochen?
Sepp Schellhorn: Ja natürlich. Nur positiv. Es ist einfach ein Zeichen, auch für Demokratie einzustehen. Israel ist in dieser Region das einzige demokratische Land. Mein Treffen mit den freigelassenen Geiseln war ein sehr emotionaler Moment. Es war irrsinnig bedrückend. Man ist fassungslos und wie gelähmt, wenn man erkennt, dass wir handlungsunfähig sind. Vor allem auch, wenn man mitbekommt, was Angehörige mitmachen. In welcher Ungewissheit sie leben müssen. Das ist für uns gar nicht fassbar. Man wird sprachlos und versucht, seine Gedanken zu ordnen und zu fassen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und ich haben jeweils eine Zitrone aus dem Garten einer Geiselfamilie geschenkt bekommen. Ich habe mich auf YouTube schlau gemacht und habe die Kerne eingepflanzt, jetzt treiben zwei Zitronenbäumchen aus. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass es nach wie vor Hoffnung gibt.
NU: Es ist gleichzeitig nicht zu fassen, wie – vor allem in der Kunstszene, in „intellektuellen Kreisen“ an Universitäten eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden hat. Israel steht am Pranger, die Hamas und ihre Slogans werden bejubelt. Wie können wir als Gesellschaft dem begegnen?
Sepp Schellhorn: Es erinnert mich in dem Diskursverhalten in einer gewissen Art und Weise an die Corona-Zeit. Es reißt tiefe Gräben in die Gesellschaft und wir müssen auch aus der Corona-Zeit lernen, dass wir das nicht zulassen. Wir müssen diskutieren, wir müssen reden. Ein kapitalismuskritischer Diskurs darf nicht in einen Antisemitismus übergreifen. Wir können uns über beide Thematiken getrennt unterhalten, aber das darf nicht verbunden werden mit Israel und vor allem nicht mit dem Gazakonflikt. Mit der gelben Schleife setze ich auch ein Zeichen dafür, dass wir diskutieren müssen, dass ich darauf ansprechbar bin und dass ich vor allem ein Verfechter der Demokratie bin. Es muss zu einem Frieden kommen und das bedingt, dass die Geiseln freigelassen werden.
NU: Sind wir da aufmerksam genug, diesen Strömungen gegenüber, die ja immer stärker werden?
Sepp Schellhorn: Nein, wir müssen viel mehr tun. Wir müssen hier vor allem Plattformen schaffen, die diesen Diskurs ermöglichen. Wir regen uns alle über antidemokratische Tendenzen in Europa auf, über unsere Nachbarn im Osten und gleichzeitig lassen wir zu, dass um Israel herum nur antidemokratische Regime agieren. Denken wir an die Gewalt gegen die Drusen. Ich würde mir wünschen, dass man hier für die Drusen genauso einsteht wie für Free Palestine. Aber hier passiert nichts. Dass nur gegen Israel protestiert wird, das macht mich wachsam, und bestärkt mich, aktiver zu sein im Diskurs. Das ist meine persönliche Meinung.
NU: An unsere Schulen gibt es keine Bildung über die Entstehung des Nahen Ostens.
Sepp Schellhorn: Wir hatten schon enormen Bedarf, auch unsere Geschichte in die Schulen hineinzubringen. Das hat ja enorm lange gedauert. Ich kann mich erinnern, dass wir 1979 auf Schullandwoche noch die „Hermann Göring Werke“ besuchten. Das hat mich damals eigentlich aufgeweckt. Wie gehen wir eigentlich mit unserer Geschichte um? Jetzt haben wir genau das Gleiche, aber mit ganz anderen Kommunikationsformen. Wir haben die digitalen Foren und das Handy, wo jeder hineinschaut und jeder auf seine Art mit den Algorithmen informiert wird. Das verstärkt die Tendenzen. Das heißt, die Schule allein kann das nicht mehr bewältigen. Die Zivilgesellschaft ist aufgefordert, auch in die Schulen zu gehen und die Politik ist aufgefordert, dass hier eine Plattform in den Schulen geschaffen wird, diesem über Algorithmen und KI aufkommenden Antisemitismus im Diskurs etwas entgegenzubringen.
NU: Wie erleben Sie das im ländlichen Umfeld. Wie ist da die Stimmung? Ist das anders als im städtischen Raum?
Sepp Schellhorn: Ich erlebe es am Land eigentlich nicht so stark wie in der Stadt. Im Wirtshaus ist es kein „Stammtischthema“. Mittlerweile kennen all meine Haltung und die ist, dass zuerst die Geiseln freigelassen werden müssen, damit man in einen Diskurs, in eine Verhandlung kommen kann.
NU: Sie haben in ihren Familienbetrieben muslimische Mitarbeiter. Wie gehen die damit um?
Sepp Schellhorn: Ich hatte einen Tag nach dem Massaker am 7. Oktober dieses schreckliche Erlebnis. Afghanische Mitarbeiter, für die wir uns sehr engagiert haben, die in unserer Demokratie sehr gut integriert wurden, die sich diese Berichte angeschaut und fast positiv reagiert haben. Das führte zu einem sehr ernsten Gespräch. Ich sagte, das ist ein Verbrechen, was hier passiert ist. Hier wurden mehr als tausend Menschen getötet und viele verschleppt. Wer das nicht anerkennt, kann gehen. Sie kennen unsere
Positionen und wissen, wie unsere Familie tickt.
NU: Fällt das auf fruchtbaren Boden?
Sepp Schellhorn: Es war für mich ein Schockmoment, dass sich jemand über das Massaker freut. Es ist unsere Verpflichtung, niemanden auszuschließen, weil er irgendeiner Ethnie angehört, oder einer Religion, sondern gemeinsam versuchen, in einem demokratischen Land einen Weg zu beschreiten.
NU: Das könnte ja eigentlich auch ein gutes Zukunftsszenario für den Nahen Osten sein. Dass sich die Staaten um Israel herum der Innovationskraft Israels anschließen könnten.
Sepp Schellhorn: Gaza ist das eine, das Westjordanland ist das andere. Hier sind große Konflikte zu bewältigen. Aber es steht außer Frage, hier geht es um eine Demokratie und rundherum gibt es nur Unterdrückung und totalitäre Systeme.
NU: Unser Heft erscheint zu Rosh Hashanah. Das jüdische Neujahr ist immer auch eine Zeit der Rückschau und eine Zeit, Bilanz zu ziehen.
Sepp Schellhorn: Für mich ist mein Amt etwas Neues. Es ist für mich nur Positives darin zu sehen, dass ich einen Beitrag leisten darf. Jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten, dass unser Leben besser wird. Das ist meine neue Aufgabe. Ich weiß, wie wichtig im jüdischen Glauben der Schabbat ist. Ich bin kein religiöser Mensch, aber das habe ich jetzt an Sonntagen: Ich muss plötzlich nicht mehr in der Küche stehen, sondern ich kann die Ruhe genießen und komme zum Lesen. Gerade jetzt das Buch von Karl Markus Gauss über den 7. Oktober 2023. „Schuldhafte Unwissenheit“. Das hat mich besonders berührt.



