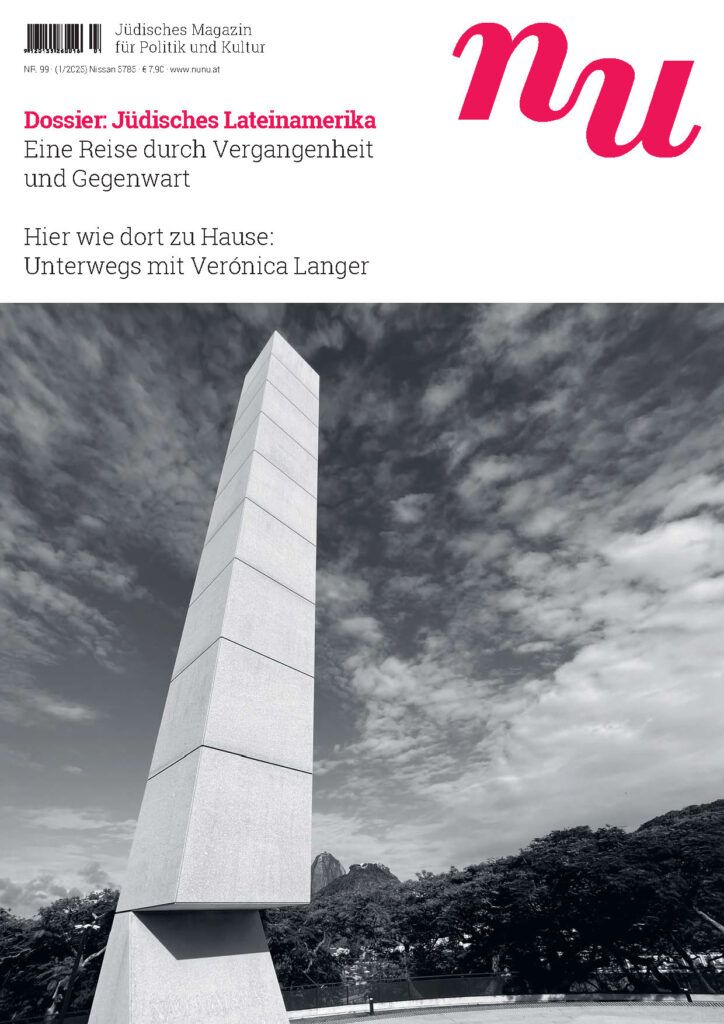Der Chassidismus ist die wichtigste und machtvollste Religionsbewegung des Judentums in der Diaspora – auch in der jüngeren europäischen Geschichte. Ein geschichtlicher Abriss.
Von Fritz Rubin-Bittmann
Gegründet wurde der Chassidismus in Osteuropa etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts von Israel ben Elieser (ca. 1700–1760), dem Baal Schem Tow, was „Herr des guten Namens“ bedeutet. Was wiederum bedeutet, dass Israel ben Elieser ein Mensch war, dem das Volk vertraut hat, der die Sorgen und Nöte der Menschen kannte, sie ernst nahm und ihnen einen neuen Weg wies, um sinnvoll und in Freude leben zu können. Zentral im Chassidismus sind Begeisterung am Leben und Weltverbundenheit mit den einfachen Leuten: Gottesliebe führt zu Menschenliebe. Der einfache Jude konnte im Chassidismus jenen gesellschaftlichen Rang erklimmen, der im talmudischen Judentum nur dem Gelehrten vorbehalten war.
„Chassid“ heißt übersetzt so viel wie „der Fromme“ und wird vom hebräischen Wort „Chessed“ (Liebe, Gnade und Gutes tun) abgeleitet. Chassidismus gab es als Bewegung bereits vor dem osteuropäischen Judentum, in der Antike. In den Psalmen und den Sprüchen der Propheten wird König David als Chassid bezeichnet. Es gibt auch Stellen in den Psalmen, in denen es heißt, dass G‘tt ein Gerechter, ein Zaddik in Seinen Wegen und ein Chassid in Seinen Werken sei.
Im Chassidismus des Israel ben Elieser steht die Freude am Dasein und die Heiligung des Alltags im Zentrum. Mit jeder Handlung und Tat, sei es Arbeit, Essen, Schlafen und Beten, kann man dem Ewigen dienen, die verstreuten Funken der „Schechina“, die Funken der verborgenen Göttlichkeit, erlösen und durch Nächstenliebe zur wahren Gottesliebe gelangen.
Israel ben Elieser verlor früh seine Eltern und kam zu fremden Leuten. Als Kind war er gern und viel in der Natur, was im Gegensatz zu den Gepflogenheiten jüdischer Kinder stand, die schon mit drei Jahren einen Cheder, eine jüdische Schule, besuchten. Als junger Mann betätigte er sich in verschiedenen Berufen, unter anderem als Schullehrer und als Schoichet, also als Schlächter. Weil er in der Pflanzenheilkunde bewandert war, konnte er vielen helfen, die sich mit ihren Gebrechen an ihn wandten. Die Menschen vertrauten ihm, und er wurde zum Schiedsrichter seiner Umgebung erkoren.
Aus der Verborgenheit
Im jüdischen Volksglauben gibt es die Vorstellung, dass die Welt in jeder Generation 36 Gerechte hat. Sie heißen „Lamed Waw“ (der hebräische Buchstabe Lamed hat den Zahlenwert 30 und der Buchstabe Waw den Wert sechs). Der Fortbestand der Welt basiert auf der Existenz dieser Lamed Wawniks, die aber selbst nicht wissen, dass sie diesem Kreis angehören. Die Verborgenen können jeder Art von Beruf nachgehen, Arzt, Lehrer, Bauer oder Kaufmann sein.
In seinem sechsunddreißigsten Lebensjahr trat der Baal Schem Tow aus seiner Verborgenheit hervor und bot sich den Menschen als Helfer dar. Im Judentum gibt es den Begriff des „Zaddik“, was so viel wie „der Bewährte“ oder „der Gerechte“ bedeutet. In den Psalmen heißt es: „Der Zaddik ist das Fundament der Welt.“ Israel ben Elieser war ein solcher Zaddik, obwohl er sich selbst niemals so bezeichnet hat. Er fand einen Zugang zu den Menschen, die in ihm aufgrund ihrer materiellen und geistigen Not den Retter sahen.
Retter aus der Krise
Zu jener Zeit befand sich das Judentum in einer geistig-religiösen und materiellen Krise. Bestimmend für die Situation war vor allem der Kosakenaufstand im 17. Jahrhundert, als Bogdan Chelmitzky mit seiner Horde zehntausende Jüdinnen und Juden grausam niedermetzelte.
Das zweite Ereignis betrifft die geistige Notlage. Aufgrund von Pogromen, Vertreibung und Verfolgung herrschte im Judentum große Sehnsucht nach messianischer Erlösung. Aus diesem Grund gründete ebenfalls im 17. Jahrhundert ein Mann namens Sabbatai Zwi aus Smyrna (dem heutigen Izmir) eine messianische Bewegung mit einigen hunderttausenden Juden als Gefolgschaft. Sabbatai Zwi vertrat die Idee der „heiligen Sünde“, durch die das Kommen des Messias herbeigeführt werden könne. Der Kalif stellte ihn vor die Wahl, entweder hingerichtet zu werden oder zum Islam überzutreten. Er wählte für sich und seine Anhänger die zweite Option, doch bei den Juden hielt sich die Vorstellung, er sei der Messias. Als man schließlich erkannte, dass die Bewegung der Sabbatianer in sich zusammengebrochen war, kam es zu einer mental-psychischen Notlage.
In dieser Krisensituation erschien Israel ben Elieser dem Volk als Retter. Er richtete die Menschen auf, machte ihnen Mut und führte sie zurück auf den Weg der jüdischen Tradition. Die von ihm gestaltete Lehre, der Chassidismus, und das Charisma seiner Person standen im Gegensatz zum rabbinischen Judentum. Er betrachtete nicht den Gelehrten, sondern auch den Unwissenden als prinzipiell gleichrangig.
Heiligung des Alltags
Es geht im Chassidismus um die „Heiligung des Alltages“, es gibt keinen Unterschied zwischen profan und heilig. Alles Profane kann geheiligt werden durch „Kawwana“ und „Schiflut“ (siehe Glossar) und jeder Mensch nach den Überzeugungen des Baal Schem Tow an der Erlösung der Welt mitwirken. Dabei spielt eine Vorstellung aus der lurianischen Kabbala eine Rolle: Danach haben sich die göttlichen Funken, die bei der Erschaffung der Welt durch ein Nicht-Standhalten verschiedener Atmosphären, der „Sefirot“, gebrochen sind, in der Welt verteilt. Diese Funken sind – in Analogie zum Exil der Juden – das „Exil G’ttes in der Welt“. Man kann also mit einer auf den Ewigen gerichteten Intention durch den Vollzug jedweder Alltagshandlung – Essen, Trinken, Wandern, Beten, familiäres Zusammensein – diese göttlichen Funken erlösen und zur „Schechinà“, zu G’ttes Herrlichkeit, zurückführen.
Etliche Elemente der lurianischen Kabbala wurden allerdings im Chassidismus überwunden, da er jede Form von Askese, die in der Kabbala verbreitet ist, ablehnt. Außerdem war die Kabbala eine esoterische Bewegung, die nur wenigen Erwählten bekannt war, während es beim Chassidismus um eine volkstümliche Bewegung voller Vitalität ging.
Feinde und Anhänger
Die chassidische Bewegung wurde von den sogenannten aufgeklärten, aus der Haskala kommenden Juden, ebenso bekämpft wie von den Mitnagdim, den orthodoxen Juden. Heinrich Graetz (1817–1891), ein bedeutender jüdischen Historiker, schrieb mit bemerkenswerter Feindseligkeit über den Chassidismus, stellte ihn als Aberglaube, als nicht erwähnenswerte Sekte dar. Die Orthodoxie sah in den Chassidim, in Baal Schem Tow eine Entartung und Entstellung des Judentums. Denn bei orthodoxen Juden stand – und steht bis heute – das Lernen im Mittelpunkt. Am meisten geachtet wurde in der jüdischen Gesellschaft der Gelehrte und nicht der Reiche. Und plötzlich waren es Wasserträger, einfache Menschen, die in ihrer „Weisheit der Einfachheit“ den Gelehrten gleichgestellt waren. Gaon von Wilna (1720–1797), einer der führenden Talmudisten seiner Zeit, sprach daher einen „Cherem“, einen Bann, gegen die Chassidim aus. Das bedeutete, dass man nicht mit ihnen an einem Tisch sitzen oder sich mit einem Mitglied einer chassidischen Familie verehelichen durfte; und man hat sie buchstäblich gejagt.
Israel ben Elieser war ein hochgebildeter Mann, dank seiner Gelehrsamkeit mutierten selbst ehemalige Gegner, Talmudisten, zu seinen Anhängern, darunter Jakob Josef von Polnoje und Dow Bär von Mesetritsch. Letzterer war ein großer Talmudist, der wie ein Eremit lebte, der sich bei seiner ersten Begegnung gegenüber dem Baal Schem Tow zunächst verächtlich äußerte. Als Dow Bär auf Ersuchen des Baal Schem Tow eine Stelle aus der Gemara, der zweiten Schicht des Talmuds, deutete, sagte der Baal Schem Tow: „Was Du gedeutet hast, ist richtig, aber ohne Seele.“ Und dann deutete er selbst dieselbe Stelle, sodass Dow Bär von Mesetritsch einer seiner wichtigsten Anhänger und nach dem Tod des Baal Schem Tow sogar dessen Nachfolger wurde.
Auch Jakob Josef von Polnoje überzeugte sich als Gelehrter davon, welches Wissen der Baal Schem Tow hatte, wobei nicht das Wissen, sondern die Weisheit des Herzens im Vordergrund stand. Es gibt im Judentum im dritten Buch Moses einen Spruch: „Werdet heilig, denn heilig bin ich.“ Darauf sagte einer der Zaddikim: „Werdet menschlich heilig.“ Und dieses menschlich Heiligwerden, das heißt in jeder Handlung auf G’tt gerichtet sein, sich in echter Brüderlichkeit, Wahrheitsliebe, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft zu üben, war in den chassidischen Gemeinden tatsächlich verwirklicht, zumindest in der ersten Epoche des Chassidismus. Es war eine heilige Gemeinschaft zwischen Schülern, den Jüngern, der Gemeinde und dem Zaddik.
Luftmenschen
In den kleinen Städten im damaligen Polen – mein Vater kam aus Nadworna, einer polnischen Kleinstadt – lebten etwa zur Hälfte Jüdinnen und Juden. Es waren zumeist arme Leute, man nannte sie „Luftmenschen“, die keine richtige Existenzgrundlage hatten und denen es oft am nötigsten fehlte. Flickschuster und Flickschneider hatten am meisten Arbeit, da sie die Kleider von den Kindern und von den Erwachsenen gewendet haben. Oft gab es in einer kinderreichen Familie nur ein Paar Schuhe, was im Sommer vielleicht kein Problem darstellte, im Winter aber sehr wohl. Doch obwohl diese Menschen in Armut lebten, waren sie nicht armselig, sondern beseelt von der Lehre, von diesem messianischen Gedanken, dass der Messias jederzeit hier und jetzt erscheinen könnte und alles Elend und alle Not hätte ein Ende.
Diese heilige Gemeinschaft ist die einzige Verwirklichung dessen, was Augustinus (354–430) „Civitas Dei“ genannt hat. Der Kirchenlehrer hatte die ideale Gemeinschaft vor Augen: eine Gemeinschaft, die G’tt sucht und in G’ttes Geboten wandelt; und diese Gemeinschaft war bei den Chassidim verwirklicht. Es war die Civitas Dei des Ostjudentums, bei dem sich das menschliche Heiligwerden tatsächlich auswirkte.