Wie bildet man die Schoah ab? Diese Frage steht seit Jahrzehnten im Mittelpunkt des Diskurses über die Weitergabe des Wissens um die Vertreibung und Ermordung des europäischen Judentums. Ein Gespräch mit Ido Bruno, Direktor des Israel Museums in Jerusalem.
Von Danielle Spera
NU: Sehen Sie in der Art und Weise, wie die israelische Gesellschaft mit dem Thema Schoah umgeht, einen Unterschied im Vergleich zur Diaspora?
Ido Bruno: Aus meiner Sicht verändert sich gerade sehr viel. Als ich in den 1960er Jahren in Israel aufwuchs, gab es noch viele Holocaust-Überlebende, ihre Präsenz war sehr stark. Ehemalige KZ-Häftlinge mit den am Arm eintätowierten Nummern gehörten damals einfach zum Straßenbild. Heute hingegen sind viele junge Menschen in Israel – und in aller Welt – weder einem Holocaust-Überlebenden begegnet, noch haben sie durch ihre Familien einen Bezug zu den historischen Fakten. Das heißt, die jüngere Generation muss in der Schule oder in außerschulischen Einrichtungen, wie Museen, über den Holocaust lernen.
Gleichzeitig handelt es sich um einen zentralen Teil der Geschichte des jüdischen Volkes und des israelischen Bewusstseins – es gibt sicher in ganz Israel niemanden, der noch nie von der Schoah gehört hat, und wir haben natürlich auch unseren offiziellen Holocaust-Gedenktag. Diese Schreckenszeit in der jüdischen Geschichte sollte nie auf die Geschichtsbücher beschränkt bleiben, als wäre sie nur eine historische Episode unter vielen. Ich bin aber auch überzeugt, dass es in anderen Ländern viele Menschen gibt, die vielleicht noch nie etwas über die jüdische Geschichte oder den Holocaust gehört haben.
Wie kann man darauf reagieren?
Hier kann die Entstehungsgeschichte des Staates Israel einen Zugang zur Wissensvermittlung über den Holocaust bieten. Sie umfasst mehrere Generationen, von den Großeltern, die als Überlebende der Schoah aus Europa und anderen Ländern kamen, über ihre Kinder und Enkel bis zu den Urenkeln. Sie haben heute durch ihre Familiengeschichte einen Bezug zum Holocaust – gewissermaßen eine Rückkehr zur Geschichte ihrer Familien und Gemeinden, aus denen sie stammten. Die wunderbare Geschichte der Staatsgründung ist in Israel weithin bekannt und kann als Einführung oder Ausgangspunkt dienen.
In den USA oder in Europa hingegen braucht es einen anderen Ansatz. Israel verfügt mit Yad Vashem über eine offizielle Gedenkstätte und Bildungseinrichtung, die dem Gedenken und der Information über die Schoah dient und die dieser Mission in umfassender Weise nachkommt. Es besteht daher kaum Bedarf für andere Museen, das historische Narrativ zu präsentieren. Das gibt anderen Kulturinstitutionen in Israel in gewissem Sinn die Freiheit, sich mit der Schoah aus anderen Perspektiven auseinanderzusetzen; so kann das Publikum das Thema aus einem anderen Blickwinkel betrachten oder sich in manchen Fällen mit Fragen befassen, die nur indirekt auf den Holocaust Bezug nehmen.
Wir im Jüdischen Museum Wien hören immer wieder die Kritik, dass wir nicht genug Bilder zeigen, die den Schrecken dokumentieren.
Ich glaube, wenn man die Geschichte des Judentums nur aus der Opferperspektive erzählt, entgeht einem die Chance, die vielfältige und reiche jüdische Kultur und die Bedeutung des Judentums im Lauf der Geschichte, in den Generationen vor und seit dem Holocaust, zu präsentieren. Man kann über die Schoah sicher auch ohne explizites Bildmaterial sprechen und aufklären. Es gibt viele Wege, die Schoah zu vermitteln. Ein jüdisches Museum sollte ein jüdisches Museum sein; wenn es Bedarf an einem Museum gibt, das spezifisch dem Holocaust gewidmet ist, dann sollte man eines errichten, wobei es natürlich nicht dazu kommen sollte, dass der Eindruck entsteht, die Schoah werde ignoriert oder verdrängt. Ich glaube, dass ein jüdisches Museum, das sich nur mit dem Holocaust befasst, in gewisser Weise an seiner Raison d’être vorbeigeht, auch wenn Erinnerung und Gedenken stets einen zentralen Platz einnehmen sollen.
In den Vereinigten Staaten arbeitet man mit Hologrammen von Schoah-Überlebenden, die fast wie lebende Menschen wirken und die mit Hilfe von Computerprogrammen Fragen beantworten können – sozusagen virtuelle Zeitzeugen, deren Einsatz vielfach diskutiert wird.
Ich habe diese Hologramme noch nicht gesehen. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf Yad Vashem hinweisen: Dort sind reale Objekte ausgestellt, und ich glaube, dass das kleinste persönliche Objekt, wenn es authentisch ist und eine Geschichte erzählt, die stärkste und eindringlichste Wirkung hat. Manche Holocaust-Museen zeigen auch Kunstwerke, die von KZ-Häftlingen geschaffen wurden. Ich finde das interessant, weil damit ein weiterer Aspekt des Narrativs angesprochen wird. Aber man sollte sich unbedingt bemühen, Originale zu zeigen; wenn man mit Kopien arbeitet, ist es zweifelhaft, ob sie ebenso eindringlich wirken würden.
Glauben Sie, dass die Tatsache, dass es bald keine Zeitzeugen mehr geben wird, einen Einfluss auf die Arbeit von Museen haben wird?
Natürlich wird das nicht ohne Folgen bleiben. Diese Entwicklung begleitet uns jetzt seit einigen Jahren, auch wenn sie zum Glück langsam voranschreitet. Wie gesagt, als ich ein Kind war, war es etwas Alltägliches, KZ-Überlebenden zu begegnen. Auch wenn nicht über das Thema gesprochen wurde, blieb es immer präsent. Das ist heute nicht mehr so; und damit hat auch das Thema selbst irgendwie an Bedeutung verloren. Holocaust-Museen stehen daher vor der Aufgabe, sich neue Strategien zu überlegen – die meisten haben seit vielen Jahren mit Zeitzeugen gearbeitet und sich auf diese Entwicklung mit Aufnahmen von Interviews und so weiter vorbereitet; auch die Hologramme von Holocaust-Überlebenden gehen letztlich auf eine solche Idee zurück. Jüdische Museen betrifft das kurzfristig noch nicht, je nachdem, was für sie inhaltlich und in der Vermittlung im Vordergrund steht. Aber wenn wir an die Zeit in 50, 100 oder 200 Jahren denken, müssen unsere Nachkommen die Holocaust-Erzählung möglicherweise neu überdenken und mit mehr Nachdruck vermitteln.
Hat sich der Umgang der jüdischen Museen mit der Schoah in den letzten zwanzig Jahren in Ihrer persönlichen Wahrnehmung verändert?
Ich glaube, die Auseinandersetzung mit dem Thema Holocaust hat sich insgesamt verändert. Vor 20 oder 25 Jahren konnte man über den Holocaust nur mit tiefem Ernst und auch einer gewissen Dramatik sprechen. Für Humor oder Ironie war da kein Platz. Das in den 1980er Jahren veröffentlichte Comic Maus. Die Geschichte eines Überlebenden wurde vielfach als völlig absurd abgetan, obwohl diese Bildgeschichte sehr dunkel war und ganz und gar nichts Lustiges vorkam. Roberto Benignis Film Das Leben ist schön war ein Wendepunkt. Zwar erntete der Film viel Kritik, aber er stand auch für einen neuen Zugang zum Holocaust. In meiner Kindheit wäre jede Leichtigkeit in der Behandlung des Holocaust ausgeschlossen gewesen; das war gänzlich unvorstellbar. Heute gibt es ganz andere Wege, die Schoah in kulturellen, künstlerischen und literarischen Zusammenhängen zu thematisieren.
Es verändert sich viel, und das bedeutet, dass junge Menschen, deren Familien nicht direkt vom Holocaust betroffen waren, sich dem Thema auf ganz andere Weise nähern und sich aussuchen können, wie sie sich darüber informieren wollen. Ich sehe das als eine positive Veränderung, in dem Sinne, dass das vermutlich der einzige Weg ist, wie man neue Publikumsschichten an das Thema heranführt. Wenn es richtig gemacht wird, kann das die Wissensvermittlung über den Holocaust bereichern. Das Thema wird damit nicht herabgewürdigt, sondern man kann im Gegenteil den Respekt und das Verständnis jedes Einzelnen dafür vertiefen.
Fest steht, dass das Gedenken an den Holocaust und seine Opfer, ebenso wie die Vermittlung von Wissen darüber, übergeordnete Zielsetzungen sind. Doch zugleich sind das nicht die einzigen Ziele, die heute angestrebt werden – es gibt auch die Lehren, die die Welt daraus ziehen kann, um sicherzustellen, dass er sich nie wiederholen wird.
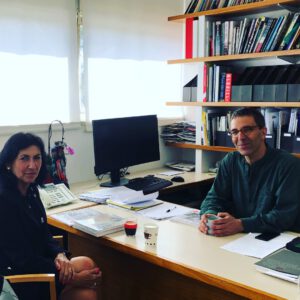
Dieses Gespräch ist ein Auszug aus „Die Zukunft der Erinnerung. Jüdische Museen und die Schoah im 21. Jahrhundert“ (12. Band des Wiener Jahrbuchs für jüdische Geschichte, Kultur und Museumswesen), hg. v. Danielle Spera und Astrid Peterle. Wien, 2020.


